 Eigentlich ist es so gar nicht meine Art, verstorbene Künstler mit einem Nachruf zu würdigen. Ich halte grundsätzlich nicht viel davon, wenn Leute, die die Verstorbenen selbst nicht kannten deren Tod dazu ausnutzen um ihren Senf zu deren Werk abzugeben. Aber im Falle des Animé-Regisseurs Satoshi Kon, welcher am 24. August 2010 seinem Bauchspeicheldrüsenkrebs erlag, komme ich nicht umhim, ein paar Worte zu verlieren. Dabei treibt mich vor allem eines an: Einem einzigartigen Genie die letzte Ehre zu erweisen, bevor es nach und nach verblasst und im Meer der Vergessenheit verschwindet.
Eigentlich ist es so gar nicht meine Art, verstorbene Künstler mit einem Nachruf zu würdigen. Ich halte grundsätzlich nicht viel davon, wenn Leute, die die Verstorbenen selbst nicht kannten deren Tod dazu ausnutzen um ihren Senf zu deren Werk abzugeben. Aber im Falle des Animé-Regisseurs Satoshi Kon, welcher am 24. August 2010 seinem Bauchspeicheldrüsenkrebs erlag, komme ich nicht umhim, ein paar Worte zu verlieren. Dabei treibt mich vor allem eines an: Einem einzigartigen Genie die letzte Ehre zu erweisen, bevor es nach und nach verblasst und im Meer der Vergessenheit verschwindet.
Satoshi Kon hat Animé-Filme gemacht. Im Gegensatz zu vielen anderen Regisseuren seines Fachs zählte Kon zu denjenigen, welche auch außerhalb Japans international Anerkennung finden konnten. Dies lag in erster Linie daran, dass er mit seinen Filmen stets die Konventionen des Animationsfilms hinterfragt und teilweise in seinen Grundfesten erschüttert hat. Das Überwinden der Genre-Konventionen, welches selbst in seinen ersten Langfilm “Perfect Blue” (1997) evident war, wurde zu seinem wichtigsten Markenzeichen. Dieser Film stellte etwas wahrlich Bahnbrechendes dar, denn er verdeutlichte wieviel mit dem Medium Animé zu erreichen war, wenn es sich als Pendant zum Spielfilm verstand und dessen Machart in Form der Animation umsetzte. Den Höhepunkt seines Schaffens erreichte Kon jedoch mit seinem Zweitwerk “Millennium Actress”, welches 2001 in Japan in Kino lief und hierzulande erstmals 2006 auf DVD veröffentlicht wurde. Dieser Film sprengte in vielerlei Hinsicht alles, was Animé vorher bedeutet hatte. Er ist zugleich fiktive Künstlerbiographie, Historienfilm, Science-Fiction und auf einer entrückten Meta-Ebene angesiedelt, welche den Zuschauer (genau wie “Perfect Blue”) intelektuell herausfordert. Im Hinblick auf die Regie fällt einem nur ein einziger Regisseur ein, den man mit Satoshi Kon vergleichen könnte: Christopher Nolan. Beide verstehen es auf brilliante Art und Weise, den Zuschauer zu täuschen und ihn zum aufmerksamen Zusehen zu zwingen wobei stets Anspruch mit optischer Brillianz einhergeht. Beide spielen mit der Wahrnehmung ihrer Protagonisten und der der Zuschauer, sodass sich ein Film erst nach mehrmaligem Anschauen in seiner Genialität erschließt. Letztlich war Satoshi Kon ein Genie vom Kaliber eines Christopher Nolan, mit dem Unterschied, dass sich letzterer einem viel größeren Bekanntheitsgrad erfreut.
Die letzten beiden Langfilme von Satoshi Kon gehören einer anderen Sorte an. “Toyko Godfathers” ist die herzerwärmende Geschichte dreier Obdachloser. Sie finden am Weihnachtsabend ein Baby und sind folglich gezwungen sich mit dem Kind und auch dem Sinn ihrer Existenz auseinanderzusetzen. Obwohl “Tokyo Godfathers” wesentlich konventioneller erzählt ist als Kons andere Werke zeichnet sich auch dieses Werk durch besondere Präzision aus, gerade bei der Charakterzeichnung. Satoshi Kons vierter und (wahrscheinlich) letzter Film “Paprika” (2006) ist eine Mischung aus Science-Fiction und Film Noir, in der sich, wie bei “Millennium Actress” verschiedene Realitätsebenen überlagern. Dabei ist die Inszenierung virtuos, der Film jedoch noch schwieriger zu durchdringen als “Perfect Blue” oder “Millennium Actress”. Für 2011 war “The Dream Machine” angekündigt, bei welchem noch nicht klar ist, ob er von Kons Mitarbeitern fertig gestellt werden wird.
Alles in Allem hatte ich mit diesem Artikel ein Ziel: Auf diesen genialen Regisseur aufmerksam zu machen! Sollte arte in naher Zukunft eine Reihe mit seinen Filmen ausstrahlen (wie sie es bei Miyazaki Anfang des Jahres getan haben) so kann ich nur empfehlen, sich diese Filme zu Gemüte zu führen, denn sie gehören zum Besten, was die Filmindustrie (Japans oder Amerikas, Animations- oder Realfilm) jemals hervorgebracht hat.
Nachruf für Satoshi Kon (1963-2010)
Filmfestival in Münster (7.-11.10.)
Wie aus dem Titel erkennbar ist, fand dieses Jahr in Münster wieder das Filmfestival der Filmwerkstatt Münster statt. Im Folgenden also in aller Kürze die selektive (d.h. durch das, was wir gesehen haben, begrenzte) Auswahl von Filmen, die im Rahmen des Festivals gelaufen sind:
Spielfilme (in willkürlicher Reihenfolge)
Unter Bauern (Premiere in Anwesenheit von Produktion, Darstellern und Marga Spiegel): Im zweiten Weltkrieg gehen westfälische Bauern das Risiko ein, eine jüdische Familie vor dem NS-Regime zu verstecken. Gut gemachter und fesselnder Film, der in eindrücklichen Bildern deutsche Geschichte erzählt, ohne dem Zuschauer eine moralische Wertung aufzudrücken. Die einfühlsame und differenzierte Inszenierung des autobiographischen Stoffes leistet ihr übriges, den Film zu einem wirkungsvollen und ergreifenden Werk zu machen, das aus dem Gros der Geschichtsbewältigungsfilme heraussticht.
Nord (norw. OmU, Produzent anwesend): Der depressive Jomar macht sich von Trondheim mit dem Schneemobil auf ins Nordland, um erstmals seinen Sohn zu treffen. Die Reise wird zu einem skurrilen Selbstfindungstrip begleitet von nicht minder absurden Gestalten, die ebenso wenig wie Jomar wissen, wer sie eigentlich sind, und gleichsam befremdliches Verhalten an den Tag legen. Die innere und äußere Reise durch eine unwirkliche Leere wird in weiten, beinahe grenzenlosen Einstellungen kunstvoll inszeniert und so der Lakonie der Handlung mehr als gerecht. Gepaart mit dem stoischen norwegischen Humor erhält dieses Roadmovie der anderen Art eine ganz eigene Note. Empfehlenswert.
Tatort “Tempelräuber” (Darsteller anwesend): Der neue Münster-Tatort als Kinopremiere vor ausverkauftem Haus. Mord im Priestermilieu, und Atheist Thiel mitten drin. Ein Plot in gewohnter Tatortmanier, der wie immer durch den Schlagabtausch zwischen Boerne und Thiel zu überzeugen weiß, auch wenn der Kriminalfall vergleichsweise vorhersehbar ist. Insbesondere der Anfang dieser Folge zeigt eine erfrischend stringente Regie und wohlgesetzte Schnitte, fällt aber alsbald auf den Tatort-Einheitsbrei zurück.
Durst: Ein koreanischer Priester überlebt eine Virus-Infektion, indem er durch eine Bluttransfusion zum Vampir wird. Fortan sieht er sich als Priester Gottes und Geschöpf des Teufels in einem inneren Widerstreit, der ihn gemeinsam mit seiner Gefährtin immer mehr entfremdet. Von diesem Gewissenskonflikt bekommt man in diesem durchweg seltsamen Vampirdrama allerdings wenig mit. Überhaupt plätschert die Handlung eher träge vor sich hin. Nach Charakterentwicklung, ausgefeiltem Plot und Kontext sucht man vergeblich. Gleichsam kommt der Streifen — von wenigen Szenen abgesehen — ohne Schock- und Horrorelemente aus, sodass man sich fragen muss: wieso, weshalb, warum musste dieser Film gedreht werden.
Nowhere Man (OmU): Tomas träumt davon, alles hinter sich zu lassen. Er macht ernst, fingiert seinen Tod, lässt Frau, Job und Freunde zurück und setzt sich nach Barbuda ab. Doch die Realität entspricht keineswegs seinem rosigen Traum. Ohne Geld und Arbeit vegetiert er von den Einheimischen missachtet fünf Jahre vor sich hin, bevor er zurückkehrt und schließlich feststellt, dass das Leben ohne ihn weitergegangen ist. Dieser bedächtig inszenierte Film räumt schonungslos mit dem Aussteigertraum auf und zeigt die Kehrseiten von gesellschaftlichem Ausstieg und dem Leben auf einer einsamen Insel.
Versailles (franz. OmU, Regisseur anwesend): Der kleine Enzo wird von seiner Mutter bei einem in den Wäldern von Versailles lebenden Landstreicher gelassen, der wohl oder übel die Verantwortung für ihn übernehmen muss und sich dadurch emotional zu öffnen beginnt. Ein charakterstarker Film über Warten und Werden, Einsamkeit und Verantwortung. Das bedächtige Tempo der ersten etwa 100 Minuten passt perfekt zur tragisch-schweren, doch federleicht erzählten Geschichte des Films. Beeindruckend auch die phänomenale Präsenz des fünfjährigen Max Baissette de Malglaive als Enzo, der durch seine schiere Anwesenheit ganze Szenen definiert. Einziger Makel an diesem wahrlich meisterhaften Gesamtwerk ist die plötzliche, unmotivierte Beschleunigung des Tempos am Ende des Films, wo die Handlung zu einer nicht mehr nachvollziehbaren Reihung von Zeitsprüngen und Ereignissen wird. Hier hätte man sich besser mehr Zeit genommen und das adäquate Tempo gewahrt. Dennoch überzeugt der Film auf ganzer Linie und verdient den Sieg im europäischen Spielfilmwettbewerb der Filmwerkstatt Münster.
Kurzfilme (in Reihenfolge persönlicher Wertung)
Fallen gelassen (30:00, Daniel Büttner, Max Baberg): Eine sensibel erzählte Geschichte über kindliche Brutalität unter Schülern, die bald eine unaufhaltsame Kette psychischer und physischer Gewalt auslöst, an deren Ende das Äußerste geschieht. Die technisch einwandfreie Animation in bewusst stilisierten Bildern transportiert die Handlung meisterhaft und taucht den Zuschauer in ein Wechselbad der Gefühle. Schon bald bleibt das herzhafte Lachen über die schonungslose Realparodie des Schulalltags im Halse stecken und weicht blankem Entsetzen über die unglaubliche Härte kindlicher Ausgrenzung und Streiche. Man kann sich diesem überaus stimmigen Werk nicht entziehen. Fallen gelassen hat zu Recht den großen Preis der Filmwerkstatt Münster erhalten.
Schautag (23:14, Marvin Kren): Jugendliche auf einer Brücke bei einer folgenschweren Mutprobe, ein Autoverkäufer, den Gewissensbisse schier zur Verzweiflung bringen, und ein ergrauter Herr, dem nur die Erinnerung und ein altes Videoband geblieben sind. Diese zunächst unabhängigen Geschichten werden in einem meisterhaften Spiel mit unterschiedlichen Zeitebenen erst behutsam verzahnt und schließlich zu einer einzigen Geschichte über Schuld, Verantwortung und Reue verwoben. Ein großartiges Werk!
Amoklove (09:20, Julia C. Kaiser): Fabian und Marie begegnen sich, werden Freunde, wollen mehr sein, lassen sich Zeit, haben nur drei Wochen - schon naht der Abschied. Eine wundervolle Geschichte über zwei Seelen, die einander zärtlich berühren. Die poetische Sprache und anmutigen Bilder der Inszenierung, die auf allen Ebenen gekonnt mit Symmetrie und subtilem Widerspruch spielt, illustrieren die Entwicklung einer zarten Liebe vortrefflich und erreichen am Ende eine derart beeindruckende Verdichtung, das einem schier das Herz zerspringen will.
Regenbogenengel (07:00, Anna Kasten): Gewalt unter Kindern, Schikane und Tritte, Wegsehen der anderen, bis die Flucht aus dem Leid auch die Flucht aus dem Leben bedeutet. Nur der kleine Bruder kennt den Plan, kann die als Märchen erzählte Geschichte allerdings noch nicht gänzlich begreifen… Den kraftvollen Bildern, der unschuldig kindlichen Stimme und der märchenhaften Verklärung von unvorstellbarem Leid kann man sich nicht entziehen. Sie lassen die erdrückende Traurigkeit und fatale Ausweglosigkeit spürbar werden und zwingen dazu, Stellung zu beziehen, nicht länger wegzusehen. Ein Meisterwerk, das mit dem WDR-Förderpreis ausgezeichnet wurde.
Edgar (13:00, Fabian Busch): Der verwitwete Edgar gehört zur einsamen Ü60-Generation. Die unausgefüllte Zeit im Ruhestand ohne Arbeit, ohne Aufgabe wird ihm zur Qual, bis er auf der verzweifelten Suche nach Aufmerksamkeit schließlich auf die schiefe Bahn als Ladendieb gerät. Ein stimmiger Film voll ironischer Heiterkeit, der den verzweifelten Hilferuf einer ausgemusterten Generation wirkungsvoll in Szene setzt, ohne auf die Tränendrüse zu drücken
Abb. 8.12 (04:40 Sarah Weckert): Eine Frau ritzt sich in ihre entblößte Brust ein Herz aus Blut. Die Wunde verheilt, eine Narbe entsteht und verblasst, doch etwas bleibt - für immer. Das Bild besticht durch eindringliche Simplizität und eröffnet zugleich einen immensen Interpretationsspielraum über Gefühle, wie sie uns berühren, und was am Ende übrige bleibt. Beeindruckend!
Cowboy (35:00, Till Kleinert): Immobilienmakler, Stadtmensch trifft bei der Suche nah neuen Objekten auf Cowboy, Landburschen. Der eine redet, der andere schraubt an seinem Trecker; der eine gut angezogen und gepflegt, der andere verschwitzt und ursprünglich. Erotische Spannung baut sich auf und entlädt sich schließlich. Am Morgen danach beginnt dann der Albtraum mit einem blutigen Kampf um Leben und Tod. Ein Film, der sich Zeit nimmt, und eine - so scheint es zunächst - einfache Geschichte in gemächlichen Bildern inszeniert, bis das Geschehen unverhofft explodiert, in schneller Folge zum Klimax führt und dann voller offener Fragen endet.
Freunde die du hast (14:00, Haik Büchsenschuss): Simons perspektivloses Dasein auf dem Land mit rechten Dumpfbacken als so genannten Freunden erfährt ungeahnten Aufschwung durch die Ankunft eines Städters. Simons Feigheit setzt dieser Liebe jedoch ein jähes Ende. Ein glaubhafter Film über das Fehlen von Mut und Perspektive, wie man es sich schlimmer nicht vorstellen kann.
Widerstand (10:00, Baris Aladag): Jugendliche Friedensaktivisten wollen auf einer Bundeswehrveranstaltung vor dem Kölner Dom mit einem Transparent demonstrieren. Dazu müssen sie zunächst geschickt der Observation durch Überwachungskamera, Lauschangriff und polizeilicher Beschattung entgehen. Ein treffender Film über den unbedingten Mut zum Widerstand mit einer gehörigen Portion Kritik am Überwachungsstaat. Beides ist heute aktueller denn je. Der Film wurde im Schulfilmwettbewerb zum Thema “Courage” mit dem ersten Preis ausgezeichnet.
Der Großvater (20:00, Nikias Chryssos): Großvater und Enkel treffen in dichten aggressiven, bald in einen abstrakten Surrealismus abgleitenden Bildern aufeinander. Was wie ein Kampf um Behauptung und Vorherrschaft beginnt, entpuppt sich als Wechselspiel zwischen Initiation des Enkels und Überlieferung durch den Großvater.
Weiche Haut (02:46, Jarek Duda): Wenn der Wahnsinn Besitz ergreift, beginnen die Stimmen im Kopf zu sprechen. Noch tragischer wird es, wenn sie die Wahrheit sprechen: “Ich liebe dich.” - “Ich liebe Dich auch nicht.” Ein prägnanter Film, der die wirre Welt aus einem verwirrten Kopf ziegt.
Das Paket (09:00, Marco Gadge): Für zwei Schmalspurganoven mit wichtiger Mission unter Zeitdruck stellt eine Baustellenampel im Niemandsland ein nicht zu überwindendes Hindernis dar. Im angespannten Leerlauf entfaltet sich ein skurriles Gespräch. Leider kommt auch der schwarze Humor mit Ausnahme weniger Pointen nicht aus dem Standgas heraus.
Bis dahin, Komplizen (04:15, Michael Spengler): Das Musikvideo zum gleichnamigen Song von Roger Trash aus dem Album “Liebe & Desaster” setzt den Songtext passend um und besticht durch die erfrischende Mischung von Realfilmelementen und gezeichneter Comic-Welt.
Wagah (13:30, Supriyo Sen): Wagah stellt den einzigen Übergang an der Grenze zwischen Indien und Pakistan dar. Für normale Bürger unpassierbar spielen sich dort täglich unter volksfestgleichen Zuständen Militärparaden und Aufzüge ab, bei denen sich beide Länder zu übertrumpfen versuchen, bis der Grenzübergang abends wieder geschlossen wird. Dabei ist er nie geöffnet; mehr als ein Blick auf die andere Seite ist nicht möglich. Ein informativer Film, der den Publikumspreis erhalten hat.
Das letzte Einhorn (02:03, Sonja Schneider): Aus Faulheit wird ein Esel bei der Entsorgung seines leeren Eishörnchens zum Einhorn. So schnell, wie diese neue Art entstanden ist, vergeht sie auch wieder: aus Einhorn wird wieder Esel. Leider zündet der skurrile Humor in diesem mit viel Liebe zum Detail als stop-motion-Animation gestalteten (Eis)hörnchen-Spiel nicht.
Notiz/Wunderblock (18:35, Hannah Hofmann und Sven Lindholm): Zu wirkungsvollen schwarz-weiß-Bildern untermalt mit eindringlichen Klaviertönen werden Kindern Erinnerungen aus der deutschen Geschichte in den Mund gelegt. Leider werden die einzelnen Geschichten nicht konsequent zusammengeführt und man gewinnt den generellen Eindruck, dass hier die Form hinter die Wirkung zurücktritt.
Patrick
Tideland
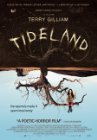 Diese Rezension wird anders, ganz anders, weil auch Tideland von Terry Gilliam so ganz anders als das ist, was wir hier normalerweise besprechen. Die einen werden den Film lieben, die anderen ihn abgrundtief hassen und so ganz sicher, zu welcher Gruppe ich gehöre, bin ich noch nicht.
Diese Rezension wird anders, ganz anders, weil auch Tideland von Terry Gilliam so ganz anders als das ist, was wir hier normalerweise besprechen. Die einen werden den Film lieben, die anderen ihn abgrundtief hassen und so ganz sicher, zu welcher Gruppe ich gehöre, bin ich noch nicht.
Erinnert ihr euch an den Sinn des Lebens von Monty Python? An den Anfang mit der “Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung”? Oder an Brazil mit dem großartigen Johnathan Pryce? Oder an Twelve Monkeys?
Die Chancen stehen gut, dass ihr, wenn ihr eine dieser Fragen mit ja beantwortet habt, euch gut an den jeweiligen Film erinnern könnt. Terry Gilliam hat eine Art, Filme zu machen, die ich sonst noch nirgendwo in dieser Perfektion und Exzentrik gesehen habe. Gilliams Filme sind immer schräg (das wird wohl die Untertreibung des Jahrhunderts sein), düster, galgenhumorig und teilweise sehr anstrengend für das Publikum. Tideland bildet hier keine Ausnahme.
Die kleine Jeliza-Rose (Jodelle Ferland, unter Anderem das kleine Mädchen aus der erstaunlich guten Silent Hill-Verfilmung) zieht nach dem äußerst plötzlichen Tod ihrer Mutter (Jennifer Tilly) mit ihrem drogenverseuchten Ex-Rockstar von Vater Noah (Jeff Bridges) mitten ins Nirgendwo in ein kleines Haus, das einmal ihrer Großmutter gehörte. Dort lässt sich Noah ein letztes Mal von seiner Tochter seine Spritze vorbereiten, bevor auch er das zeitliche segnet und Jeliza-Rose mit ihren vier Freundinnen, den Puppenköpfen Mustique, Sateen Lips, Glitter Gal und Baby Blonde allein lässt.
Bei ihren Streifzügen durch die Felder der Umgebung trifft Jeliza-Rose Dell (Janet McTeer), Geist, Meuterer und Präparatorin in einer Person und ihren Bruder Dickens (Brendan Fletcher), die zunächst ihren Vater so präparieren, dass er weiter unter ihnen weilen kann und schließlich Jeliza-Rose in ihre Familie aufnehmen, wobei noch so einige weitere Überraschungen auf sie warten…
Gilliams Romanverfilmung hat nicht nur das Publikum sondern auch die Kritiker in zwei Lager gespalten. Die einen halten das Ganze für einen visionären Film, der die fiebertraumhafte Qualität von Alice im Wunderland mit ein bisschen David Lynch und einem großen Schuss Terry Gilliam verquirlt und zu einem meisterhaften Plädoyer für die Widerstandsfähigkeit von Kindern verkocht, andere finden Tideland schlicht sinn-, zweck- und inhaltslos.
So kontrovers der Film selbst aber auch sein mag, die Bilder, die er dem Zuschauer in den Geist projiziert, sind geradezu fantastisch. Alles wirkt so verquer, so konfus, so schräg (und ich meine hier nicht nur die Kameraperspektiven), dass es eine wahre Freude ist. Wechselnd mit den großen, weiten Landschaftsaufnahmen entsteht hier ein wirklich interessanter Gegensatz.
Jodelle Ferland hat den gesamten Film zu tragen und meistert diese Aufgabe mit Bravour. Ich möchte mir zwar nicht vorstellen, wie ein zehn- oder elfjähriges Kind Dreharbeiten wie bei Tideland oder Silent Hill ohne größere seelische Probleme übersteht, wünsche ihr aber alles Gute und bin aufs Neue von ihren Fähigkeiten äußerst beeindruckt.
Nach Brothers Grimm, bei dem Gilliam von Studiobossen und Kinokassenerfolgsdruck so eingeengt war, dass beinahe nichts mehr von seiner filmischen Genialität übrig blieb, ist Tideland nun also wie die Ohrfeige ins Gesicht der klassischen Hollywood-Maschinerie. Der Film, der an den Kinokassen erwartungsgemäß floppte, in Deutschland direkt nur auf DVD erschien, beinhaltet die zwei gilliamsten Stunden, die je für ein Publikum verfügbar waren.
Ob dem geneigten Zuschauer diese Vision gefällt, hängt in erster Linie davon ab, ob er bereit ist, sich auf den Sturz in den Kaninchenbau, in dem alles, aber auch wirklich alles auf einen warten kann, einzulassen. Wie Gilliam in seinem Vorwort (!) zum Film sagt:
Many of you are not going to like this film. Many of you, luckily, are going to love it and then there are many of you who aren’t gonna know what to think when the film finishes but hopefully, you’ll be thinking.
Solltet ihr euch Tideland tatsächlich ansehen wollen, vergesst alles, was ihr übers Filmemachen, über Gott und die Welt wisst und seht diesen Film mit den Augen eines Kindes. Und ich rate euch: Seht ihn euch an. Es ist – so oder so – ein Erlebnis.
Fünf von fünf Monsterhaien für Tideland – aber ich fand ja auch Eternal Sunshine of the Spotless Mind grandios, YMMV!
Dennis
- Tideland bei imdb
- The Imaginarium of Doctor Parnassus
- Gilliams neuer Film, der letzte mit Heath Ledger
Okami (Wii)
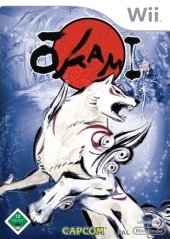 Oh oh, es riecht nach Blasphemie in diesen heiligen Sneakcast-Hallen: Dennis bespricht ein Videospiel. Naja, nicht irgendein Videospiel…
Oh oh, es riecht nach Blasphemie in diesen heiligen Sneakcast-Hallen: Dennis bespricht ein Videospiel. Naja, nicht irgendein Videospiel…
Wie die Kategorie dieses Artikels etwas kontrovers andeutet ist Okami ein Kunstwerk – und was für eins. Zwar gibt es das Ganze schon seit mehr als einem Jahr für die Playstation 2, seit heute ist das Spiel aber auch für die Wii (die, meiner bescheidenen Meinung nach, einzig innovative Konsole) verfügbar. Doch, was ist Okami?
Okami ist zunächst einmal ein japanischer Ausdruck für Wolf und damit sind wir direkt dabei: Ihr spielt Amaterasu, die Wiedergeburt von Shiranui, einer auf die Erde (genauer gesagt in das klassische Japan) gekommenen Manifestation eines Sonnengottes. Dieser hat vor hundert Jahren zusammen mit dem Helden Nagi den Dämon Orochi besiegt und in eine bewachte Höhle verbannt. Doch wie man das so kennt, hält keine Verbannung für immer und so wird auch Orochi befreit und bringt wieder Unheil über die Welt. Somit ist es an Amaterasu (und dem Sidekick Issun), Orochi zu bändigen und die Welt zu retten.
Das alles ist nicht wirklich außergewöhnlich und obwohl die Story von Okami ganze Bände füllen könnte (allein die ersten zwanzig Minuten des Spiels verbringt man mit der Einführung in die hier kurz umrissene Geschichte, bevor man den Controller überhaupt in die Hand nehmen kann), hat man auch Geschichten in diesem Umfang bereits gesehen. Was Okami anders macht, fällt aber eigentlich direkt nach dem Einlegen der DVD auf: Der Stil des Spiels - und so kommen wir wieder zum Thema Kunst zurück.
Okami ist wie ein Gemälde aus den feudalen Zeiten Japans. Amaterasu läuft durch eine Welt, die - je nach Fortschritt des Spielers - entweder aus düsteren, bedrohlichen Grün- und Brauntönen oder aus überschwänglichen Farben samt fallender Blütenblätter und Wind in den Bäumen besteht; selbst die Zwischensequenzen haben die körnige Textur von feinem Papier im Hintergrund und wirken wie gemalt.
Das Highlight des Spiels hat genau mit dieser Idee zu tun: Jederzeit hat der Spieler die Möglichkeit, das Geschehen anzuhalte und als Gemälde zu betrachten. Mit der Wiimote (der Wii-Fernbedienung) lassen sich nun Pinselstriche auf dem Papier führen, die dann, nach Fortsetzen des Spiels, ihre Wirkung entfalten. Je nach Malgeschwindigkeit und Abstand zum Fernseher entstehen dünne oder dicke Linien, die unterschiedliche Auswirkungen haben. Natürlich gibt es hier die obligatorischen destruktiven Zeichen (ja, auch die von allen Zelda-Spielern geliebte Bombe ist dabei), aber auch beispielsweise eine Geste, um Bäume wieder zum Blühen zu bringen, Seerosenblätter auf dem Wasser erscheinen zu lassen oder komplette Gegenstände aus dem Nichts zu erschaffen.
Auch wenn das hier sehr umständlich und theoretisch klingt: Das Ganze ist sehr gut in das Spielgeschehen integriert und wenn man sich erst einmal an die Steuerung und Tastenbelegung gewöhnt hat, geht einem der Wechsel zwischen den Modi leicht von der Hand.
Ungewöhnlich dabei: Okami nimmt sich trotz der durchaus ernsten Storyline selbst nicht ganz so wichtig. Hier schläft ein Charakter während eines längeren Monologes seines Gegenübers schon einmal ein und muss erst wieder aufgeweckt werden, bevor es in der Story weitergehen kann. Glück (eine Art Erfahrungspunkte für alle Rollenspieler) gibt es nicht nur durch das Lösen von Aufgaben oder Besiegen von Gegnern, sondern auch für das Füttern von diversen Waldtieren, die alle ihre eigenen kulinarischen Vorlieben haben.
Wirklich beurteilen kann ich Okami natürlich noch nicht - ich habe gerade einmal die ersten fünf Stunden Spielzeit hinter mir und habe damit gerade einmal an der Oberfläche gekratzt. Trotzdem zieht mich das Ganze wie schon seit Jahren kein Spiel mehr in seinen Bann.
Natürlich gibt es auch ein paar kleine Kritikpunkte (die zeitweise unpraktische Kameraführung zum Beispiel), aber alles in Allem überwiegt das Gefühl, hier ein Stückchen Software in der Hand zu halten, das endlich einmal wieder mit Liebe zum Detail, Herzblut und sehr, sehr viel Zeit entwickelt wurde.
Und was ist Kunst eigentlich anderes?
Fünf von fünf Pinselstrichen für Okami. Skeptiker sollten sich das Gameplay-Video ansehen oder das Spiel wenn möglich einmal antesten. Wer nach der ersten halben Stunde nicht gefesselt ist, der darf dann gerne wieder ins Museum gehen, um Werke der klassischen Postmoderne unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Veränderungen durch die Einführung der elektrischen Schreibmaschine zu besichtigen. Denn Kunst ist ja schließlich glücklicherweise Ansichtssache.
Dennis
Shakespeare in the Park: Twelfth Night
Die studentische “Shakespeare in the Park”-Produktion Twelfth Night von Beth Wynstra (Isla Vista Arts) möchte das volksnahe Theatererlebnis aus dem 17. Jahrhundert in die Neuzeit verfrachten. Was liegt da näher, als die Aufführung unter freien Himmel in einen Park zu verlegen und das Publikum, das sich im Gras lümmelt, bereits im Programmheft mit folgenden Worten zu ausgelassenem, lautem und rüpelhaftem Verhalten zu animieren:
“In Shakespeare’s day [sic] theater was more like football than art. The spectators were loud and rowdy. We want to make this experience as close to the original as possible… so be loud and rowdy.”
Doch bevor das Stück beginnt, muss das Publikum auch tatsächlich in die vom Programmheft geforderte Stimmung gebracht werden. Dies geschieht mittels eines einfachen Spiels:
“When I say ‘thing’, you say ‘PENIS’. Thing — PENIS! — Thing — …
When I say ‘nothing’, you say ‘VAGINA’. Nothing — VAGINA! — Nothing …
When I say …”
Erstaunlich, wie das Publikum — größtenteils Studenten — diese Worte immer und immer wieder aus voller Kehle mit Inbrunst und Genuss herausschreit, als wären sie sonst verboten und dürften im Alltag niemals ihren Lippen entweichen. Vermutlich ist auch das ein Teil von Amerika. Genau wie der kostenlos vor der Aufführung angebotene Kaffee und Kakao; letzterer als Instant-Pulver mit Mini-Marshmallows zum selbst aufbrühen — einfach nur skurril. Die Stimmung aber dürfte ganz in Shakespeares Sinne gewesen sein.
Was die sieben studentischen Schauspieler dann als Twelfth Night unter Regie von Jason Narvy auf der Bühne und mitten im Publikum zum Besten gaben, war unterhaltsam, kurzweilig und… kurz. Letzteres überrascht kaum, war das Spektakel doch als “Shakespeare in nur einer Stunde” angekündigt worden. Auch wenn es statt 60 letztlich ganze 75 Minuten wurden, gewährt diese Einstellung einen tiefen Einblick in das amerikanische Selbstverständnis. Sich als Student zwei oder gar drei Stunden Theater am Stück anzusehen ist so absurd, dass man gar nicht daran denken mag.
Alles in allem war die Aufführung — gerade durch das mitmachende Publikum — wirklich ein Erlebnis. Leider wurde das harte nachmittägliche Sonnenlicht dem Mienenspiel der Darsteller nicht gerecht und viele der zahlreichen obszönen Anspielungen und lüsternen Konfrontationen des Stücks wirkten wenig glaubhaft, weil die Schauspieler nicht breit waren, gewisse Grenzen zu überschreiten. Verständlich, aber dennoch schade.
Patrick
Faust – Der Tragödie erster Teil
 Unter Regie von Markus Kopf geben die städtischen Bühnen Münster Goethes Faust. Und schon vor der folgenden Rezension muss ich sagen: Wenn Ihr irgendwie die Möglichkeit habt, schaut ihn Euch an! Doch nun der Reihe nach:
Unter Regie von Markus Kopf geben die städtischen Bühnen Münster Goethes Faust. Und schon vor der folgenden Rezension muss ich sagen: Wenn Ihr irgendwie die Möglichkeit habt, schaut ihn Euch an! Doch nun der Reihe nach:
Ostersonntag, der 23. März, war der erste Termin genau einen Monat nach der Premiere, für den es noch Karten gab, und der letzte, an dem ich noch in Münster/Deutschland war. Heute, fast einen Monat danach, habe ich die Inszenierung soweit verdaut (sofern man Faust als Normalsterblicher überhaupt verdauen kann) und obendrein noch ein paar Minuten Zeit für eine Rezension.
Da die städtischen Bühnen Münster praktisch ausnahmslos modern inszenieren, hat man sich bereits an ausgefallene Bühnenbilder gewöhnt. Trotzdem war die Verblüffung beim Betreten des Saals groß: Eine quadratische Bühne bedruckt mit Goethe-Zitaten inmitten des Saals und das Publikum diesseits und jenseits der Bühne. Außerdem eine Empore, auf der das Lippe-Saiten-Orchester unter Leitung von Tankred Schleinschock positioniert ist, und ein Laufsteg quer durch die Zuschauerplätze. Links und rechts der Bühne ausgedünnte Bestuhlung und Schauspieler statt Zuschauer. An den Wänden fünf Leinwände, auf die vor Beginn des Stücks Filmausschnitte projeziert werden.
Es lohnt sich, bereits einige Zeit vor Beginn des Stücks Platz zu nehmen, um sich diese Videos anzusehen. Passanten aus der münsteraner Fußgängerzone wurden zu Faust befragt oder mussten mit Doktorhut und Teufelshörnern auf dem Kopf Szenen aus Faust lesen - wahrlich ergetzend.
Das Stück beginnt schließlich, indem die Videoaufnahmen von farbenfrohen, psychedelischen Animationen abgelöst werden und Engel, die der Kinderchor des Paulinum stellt, auf den Rängen auftauchen. Mephisto (Johann Schibli) in trendiger Gothic-Gewandung auf der Bühne und Gott delokalisiert von wechselnden Chorknaben gesprochen werden auf den Leinwänden von einem visuellen Augenschmaus begleitet, der deutlich an Kubricks 2001 - Odyssee im Weltraum erinnert. Was unter weiterhin massiven Einsatz von Livemusik und Video (Martin Kemmer) folgt, ist Goethes Faust in einer sinnvoll gekürzten, erfrischend modernen Inszenierung.
Wolf-Dieter Kabler gibt den Faust als klassischen Gelehrten, bleibt dabei aber in meinen Augen hinter seinen Möglichkeiten als exzellenter Schauspieler zurück. Gerade in den Kernszenen Nacht (Fausts Streben), Studierzimmer (Teufelspakt), Wald und Höhle sowie Kerker nimmt man seinem Spiel die Größe und Schwere der Handlung schlicht nicht ab. Vielleicht können diese Szenen in ihrer gigantischen Tragweite per se nicht durch Schauspiel sondern nur durch die ureigene Kraft der Sprache, der Verse selbst transportiert werden. Das zurückhaltende Spiel ließe sich so zwar rechtfertigen, doch gereicht Kablers deutlich beschleunigtes Sprechtempo Goethes Wortgewalt leider nicht zur Ehre.
Johann Schibli geht dagegen in seiner Rolle als Mephisto perfekt auf. Der mit Inbrunst dargestellte hechelnde Pudel, dessen Zungenspiel ihn das gesamte Stück über begleitet, das Auftreten als fast schon sympathischer Rocker, die wirkungsvolle Obszönität und Lüsternheit, die nie plump wirkt, und das stete subtile Manipulieren machen Mephisto hier zu einer durch und durch glaubhaften Teufelsgestalt. Er ist wahrlich kein Satan, sondern tatsächlich der Verneiner, der Lügner, der subtile Teufel, dem man seine stete Bosheit kaum anmerkt, dem man verfällt ohne es zu merken.
Absolut treffend und unvergleichlich, wenn er vor der Valentinszene “Highway to Hell” von AC/DC singt.
Faust ohne Gretchen wäre nichts. Leider wird das in vielen Inszenierungen vergessen, wenn man dem Publikum ein flaches, charakterloses mehr oder weniger hübsches Mädchen vorsetzt, das stumpf seinen Text herbetet. Glücklicherweise ist das hier ganz anders: Tina Amon Amonson spielt das Gretchen alles ander als platt. Glaubhaft und ausdrucksstark vermittelt sie den Konflikt zwischen süßer Liebe und kirchlicher Tugend, der schließlich in Tragödie und Wahnsinn gipfelt. Schade nur, dass sie etwas zu viel singen muss. Ist die musikalische Interpretation des König-von-Thule-Liedes noch gelungen, so leiden doch andere Szenen darunter - vor allem Marthens Garten. Hier wäre der gesprochene Text deutlich wirkungsvoller.
Generell hinterlässt der stete Einsatz von Musik aber einen positiven Gesamteindruck. Die Gesangs- und Tanzeinlagen fügen sich (mit obiger Ausnahme) nahtlos in das Gesamtkonzept und lassen die Inszenierung keineswegs zu einem belanglosen Musical verkommen. Insbesondere die Szenen Osterspaziergang (folkloristisch, aufmunternd), Auerbachs Keller (fetzig, disko), Am Brunnen (erschütternd, eindrücklich) und Hexenküche (mystisch, ekstatisch) profitieren merklich von der Musik. Letztere Szene ist übrigens ein gar besonderes Spektakel mit Christiane Hagedorn als wahrhaft reizender Hexe.
Es bleibt zu erwähnen, dass die Inszenierung sehr zu meiner Freude die Satanszene aus Goethes Paralipomenon P50 enthält. Es wird wohl ein ewiges Rätsel bleiben, warum die Szene in Goethes finaler Fassung des Faust nicht enthalten ist. Leider erfährt sie nachwievor zu wenig Beachtung, insbesondere da sie in meinen Augen einen integralen Bestandsteil des Faust darstellt. Einerseits konkretisiert das Auftreten Satans die Definition von Mephisto und macht deutlich, dass Mephisto lediglich einen Teil des teuflischen verkörpert, nämlich das Verneinen, Leugnen und Verkehren. Satan dagegen ist die offenen Perversion, Gewalt und Schändung. Andererseits bietet die Satanszene als “Intermezzo in der Hölle” einen Kontrapunkt zum Prolog im Himmel und kompletiert so den metaphysischen Rahmen um das Schicksal des Menschen symbolisiert durch Faust.
Die Textfassung der Satanszene erscheint gemessen an der heute in den Medien üblichen Wortwahl und Ausdrucksweise fast schon lieblich. Dieser Eindruck relativiert sich jedoch, macht man sich erst die gesamte Tragweite der Szene deutlich. Die Inszenierung schöpft hier entsprechend aus dem Vollen: Die Videoleinwände zeigen den Text der Szene in einer sich überschlagenden Folge stroboskopartiger Blitze. Auf der Bühne feiern Hexen und Satansjünger einen ekstatischen Reigen, während der Herr der Finsternis seine Predikt hält und das Publikum blinkende Teufelshörner trägt. Aus dieser orgiastischen Anbetung fallen Faust und das Publikum unvermittelt in die finale Tragödie.
Alles in allem eine moderne und überzeugende Inszenierung, die ich Euch gerne empfehle. Manchem mag die Modernersierung sicher nicht gefallen, wird Goethe doch als eine der unverrückbaren Säulen der deutschen Literatur gehandelt und seine Texte als absolut angesehen. Hier muss ich mich man sich allerdings fragen, inwieweit dieser starre Absolutätsanspruch dem aufgeschlossenen Menschen Goethe gerecht wird.
Nächstes Jahr gibt es den zweiten Teil, den man eher selten auf der Bühne zu sehen bekommt. Ich bin gespannt.
Patrick
Das Röntgen-Museum
 Stell’ dir vor, da ist ein Museum und keiner geht hin…
Stell’ dir vor, da ist ein Museum und keiner geht hin…
Gut, der typische Anfangs-Zwanziger hat in seiner Freizeit häufig besseres zu tun, als sich in Museen herumzutreiben; es locken Bars, Parties und die Einkommenssteuererklärung (so man nicht den Weg des Studierens gewählt hat - einen Vorteil hat das Ganze dann wohl doch). Doch wenn es einmal Nachmittag wird, man langsam aus dem Dämmerschlaf der vorherigen Nacht erwacht ist, das Wetter zwischen Schnee und T-Shirt-Eignung hin und her pendelt, dann kommt man manchmal auf Ideen.
[Warning: Lokalpatriotismus ahead] Ihr Gipsträger dieser Welt, ihr Autobesitzer, Gallensteingeplagten, Astronomen und Mumienfans: Ihr alle hättet wenig zu lachen, wäre vor etwas mehr als hundert Jahren ein wundersamer Herr aus dem von hier aus einen Steinwurf entfernten Lennep nicht auf die Idee gekommen, die Hand seiner Frau in eine Maschine zu stecken, die mindestens ebenso wunderlich war, wie er selbst…
Der Herr Röntgen (Wilhelm Conrad, wie ihn seine Freunde nannten) fand, richtig Kinder, die Röntgenstrahlen, die zunächst als Jahrmarktattraktion und sogar Mittel zur Verbrechensbekämpfung, ebenso (und heute ja auch noch) zu medizinischen, materialtechnischen und noch viel merkwürdigeren Zwecken genutzt wurde.
Genau diesem Herrn Röntgen hat man bereits vor diversen Jahren ein Museum gebaut; eines dieser üblichen 70er-Jahre-Museen mit ein paar Knöpfen, die ein paar Blinklichter ihre Arbeit tun lassen, aber drumherum mit ganz viel Text, etwas weniger Bildern und noch weniger Begeisterungsfähigkeit für kleine und große Entdecker. Seit einigen jahren ist man nun mit dem Umbau beschäftigt und mittlerweile ist der erste Teil abgeschlossen.
Das einst latent staubige Museumsflair wurde durchgehend durch Modernität ersetzt. An den Wänden hängen hippe Touchscreens, die dem Besucher die Informationen liefern, die er gerade haben möchte. In Röntgens Arbeitszimmer steht ein Schreibtisch, in dem neugierige Kinder auch schon mal die Rechnung vom Seifenhändler um die Ecke, unterschrieben von Röntgen persönlich, finden können. Alles ist anfass- und benutzbar, auch der Flipper, mit dem man Elektronen durch die Gegend schießen oder das Terminal, an dem man die Unterschiede zwischen Röntgenstrahlung und sichtbarem Licht anschaulich selbst ausprobieren kann.
Dazwischen gibt es viel, viel zu sehen, besonders natürlich Massen an Röntgenaufnahmen (eine Frau beim Schminken, eine Taschenuhr, eine Geige…) und Geschichten um ihre Entdeckung.
Noch ist das Ganze nicht fertig, der Rest des Umbaus soll erst 2009 beginnen. Schon jetzt lohnt sich aber ein (kostenloser!) Besuch, gerade für diejenigen, die eigentlich mit Museen nicht viel anfangen können.
(Und jetzt wartet nur, bis ich die Eindrücke aus dem Louvre in Paris von vor einigen Monaten verdaut habe…)
Dennis

